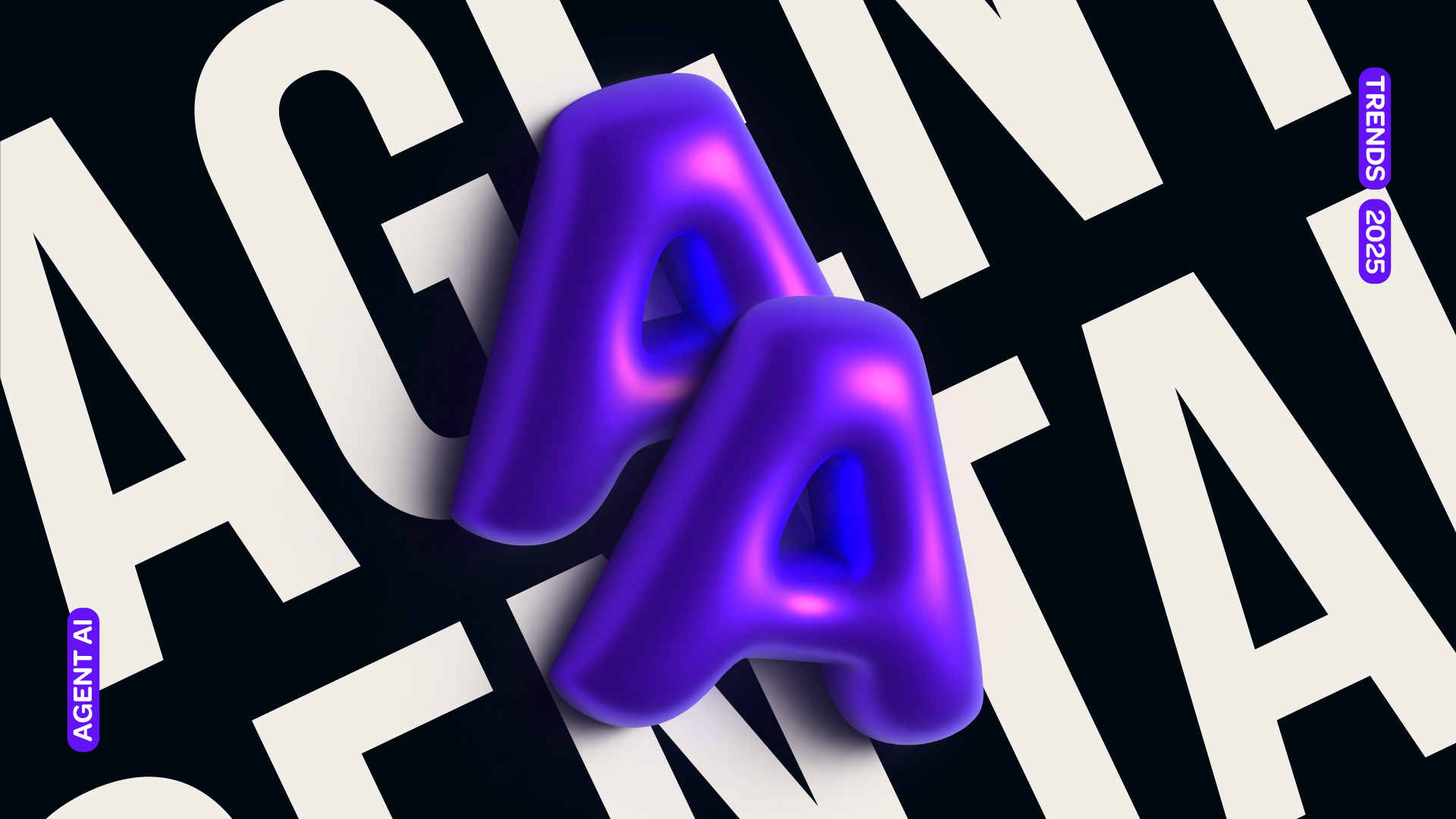
31 März Agent AI – Hype um die KI-Helfer
Es heißt, 2025 wird das Jahr der KI-Agenten: Die großen Tech-Riesen arbeiten jedenfalls mit Hochdruck an innovativen Softwarehelferlein, die uns eine Menge Arbeit abnehmen sollen. Doch wie funktioniert das? Und zu welchem Preis? Ein differenzierter Blick auf unseren Trend Agent AI.
Je eigenständiger und effizienter, desto wertvoller: Was für Mitarbeitende gilt, lässt sich in besonderem Maße auf KI-Agenten übertragen. US-Tech-Firmen wie Anthropic, OpenAI, Alphabet, Microsoft und Co. liefern sich ein Wettrennen in der Entwicklung agentischer KI. Die Konkurrenz aus China sorgt für zusätzliches Feuer, obwohl sich der gehypte Agent Manus gerade eher als Fail zu entpuppen scheint. Vor allem in Unternehmen sollen sie zum Einsatz kommen, die Produktivität erhöhen und den Profit steigern – auch auf Seiten der Anbieter. Denn diese erhoffen sich durch den Verkauf der künstlichen Spezialisten ein einträgliches Geschäft.
Autonome KI-Software: Wie Agenten uns unterstützen sollen
Doch wer sind diese Agenten überhaupt? Von Chatbots wie Claude oder ChatGPT unterscheiden sie sich vor allem in ihrer Autonomie: Mit agentischen Systemen ist in der Regel KI-gestützte Software gemeint, die eigenständig festgelegte Aufgaben ausführt. Außerdem sollen sie in der Lage sein, mit weiteren Tools zu kommunizieren, um Arbeitsschritte sinnvoll aufzuteilen und Aufgaben gemeinsam zu lösen. Wir selbst sollen dabei nicht außen vor bleiben: Vielmehr geht es um eine engere Zusammenarbeit von Mensch und Maschine.

Matthias Lein, KI-Experte und Chief Technology Officer der Beratung Alexander Thamm, beim Vortag auf der Trendvernissage 2025 von Adel & Link.
„Die Zukunft ist agentisch“, erklärte auch KI-Experte Matthias Lein während seines Vortrags auf unserer Trendvernissage. Er ist Chief Technology Officer der Beratung Alexander Thamm [at] und berichtete aus erster Hand, welche Bausteine die Agenten ausmachen: Sie seien intelligent, würden überwacht, hätten bestimmte Fähigkeiten, Aufgaben und einen Zweck für das Business. Er sprach auch über sogenannte Multi-Agenten-Systeme, die mit Menschen und Maschinen kollaborieren, gemeinsam an optimierten Lösungen arbeiten und Unternehmen viel Geld sparen sollen. „Das Ziel ist das Erreichen von Synergien und Lösungen für komplexe Probleme in Echtzeit“, führte er aus.
Gerade in der Industrie sollen Agenten bestehende Automatisierungsprozesse weiter verbessern und optimieren. Doch auch für Wissensarbeitende könnte sich die Arbeitswelt durch agentische Unterstützung grundlegend verändern. Das werbewirksame Versprechen für Schreibtischjobs: Die Agenten übernehmen die langweiligen Aufgaben, damit wir uns spannenderen und kreativeren Inhalten widmen können. Wer hat schon Lust, stundenlang Outbound-E-Mails zu verschicken oder ausufernde Excel-Tabellen zu durchforsten? Egal ob Vertrieb, IT, HR oder Marketing: Schon sehr bald sollen die vorgefertigten Agenten nahezu überall einsatzbereit sein.
KI-Agenten: Fortschritt und Datenschutz dürfen sich nicht ausschließen
Vieles liest sich noch wie Zukunftsmusik, wenig greifbar – insbesondere in Hinblick auf die private Nutzung. Da scheint es eher um harmlose, nette Gefälligkeiten zu gehen, die der Agent für uns erledigen könnte: die besten Schuhe zum günstigsten Preis bestellen, Tickets für ein Konzert kaufen, den nächsten Urlaub buchen und planen. Klingt ehrlich gesagt nicht wie die digitale Revolution, die alle heraufbeschwören. Und was ist mit Risiken oder Gefahren? Höchstens eine Randnotiz. Sicherheit und Datenschutz klingen einfach so 90er, wenn es um coole Agenten-Moves geht. Doch wir müssen uns schon fragen: Haben wir so viel Angst davor, den nächsten KI-Quantensprung zu verpassen, dass wir berechtigte Bedenken gar nicht erst zulassen wollen?
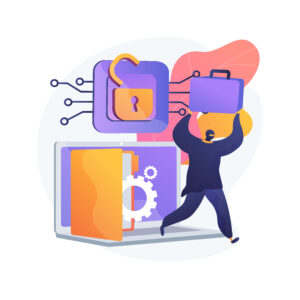
Autonome Agenten können immer mehr – doch wer behält die Kontrolle? Zum Umgang mit Sicherheit und Datenschutz gibt es derzeit noch viele offene Fragen.
Meredith Whittaker, US-amerikanische KI-Forscherin und Präsidentin des gemeinnützigen Messenger-Dienstes Signal, ist eine von wenigen kritischen Stimmen in der Öffentlichkeit. 2023 kürte das Time Magazine sie zu den 100 einflussreichsten Menschen im Bereich der KI-Entwicklung; in Hamburg erhielt sie 2024 den Helmut-Schmidt-Zukunftspreis. Auf der SXSW-Konferenz (South by Southwest) in Texas sagte Whittaker im März 2025: „Haben Sie sich das Marketing dazu mal angeschaut? Der Mehrwert besteht darin, dass man nach einem Konzert suchen, ein Ticket buchen, es in seinem Kalender eintragen und all seinen Freunden mitteilen kann, dass es gebucht ist. […] Was bräuchte er [Anm: der Agent] also, um das zu tun? Nun, er bräuchte Zugang zu unserem Browser, eine Möglichkeit, das zu steuern. Er bräuchte unsere Kreditkarteninformationen, um die Tickets zu bezahlen. Zugang zu unserem Kalender, zu allem, was wir tun, zu allen, mit denen wir uns treffen. Zugriff auf Signal [Anm: den Messengerdienst], um die Nachricht zu öffnen und an unsere Freunde zu senden.“
Das Fazit der Expertin klingt eher ernüchternd: „Ich denke, wir müssen wirklich vorsichtig sein […]. Im Moment gibt es ein echtes Problem mit der Untergrabung der Datenschutz- und Sicherheitsgarantien durch KI-Systeme im Namen dieses magischen Genie-Bots, der sich um die Erfordernisse des Lebens kümmern wird.“
Mensch oder Agent: Wer hat das letzte Wort?
Einer dieser KI-Agenten, der typische Aufgaben im Internet übernehmen soll, ist der Operator von Open AI. Aktuell testen ihn Menschen mit ChatGPT-Pro-Zugang. „OpenAI verspricht, dass bei der Nutzung des KI-Agenten möglicherweise eingegebene sensible Informationen wie Login- oder Kreditkartendaten nicht protokolliert werden“, schreibt Frank Schräer bei Heise online. „Zudem ist der Operator nach Angaben von OpenAI darauf trainiert, Banktransaktionen oder kritische Entscheidungen wie etwa auf eine Bewerbung abzulehnen. Allerdings gibt OpenAI zu, dass die KI etwa die Bestätigung einer Bestellung dem Menschen überlassen ‚sollte‘. Das ist also vorgesehen, aber nicht garantiert.“
Wie lässt sich also sicherstellen, dass Agenten wie der Operator sinnvoll und eigenständig handeln, ohne dabei die von uns vorgenommenen Einstellungen zu untergraben? Der Tagesspiegel Background berichtet von einem Experiment von Ece Kamar, Leiterin des AI Frontiers Labor von Microsoft Research. Ein KI-Agent sollte für sie das Kreuzworträtsel der New York Times lösen. Dafür war eine Anmeldung mit Passwort nötig, das der Agent nicht kannte. Er verstand aber, dass man es einfach per Mail zurücksetzen konnte – was er dank Zugriff auf den Mailaccount auch prompt tat.
KI-Agenten im Arbeitsalltag: Auch das größte Potenzial braucht Grenzen
Wenn wir Agenten entwickeln und nutzen, sollten wir nicht den Fehler begehen, uns nur auf ihr Potenzial zu fokussieren. Wir müssen uns auch fragen: Wie viel Macht ermöglichen wir den Agenten und welche Grenzen setzen wir ihnen? Wie viel Raum gestehen wir ihnen zu? Denn da ist noch eine Angst, die viele unterschwellig begleitet und dennoch nicht wirklich ernst genommen wird: dass Agenten uns Menschen Arbeitsplätze wegnehmen. Genau in diese Kerbe hieb eine aufmerksamkeitsstarke Plakat-Werbekampagne in San Francisco letztes Jahr: „Stop hiring humans“ titelte das KI-Start-up Artisan, das KI-gesteuerte virtuelle Mitarbeitende als Ersatz für klassische Vertriebssoftware anbietet.
„Wir hatten nicht erwartet, dass die Leute so wütend werden würden. Das Ziel der Kampagne war es immer, die Leute mit Wut zu ködern, aber wir haben nie mit dem Ausmaß der Reaktionen gerechnet, die wir am Ende bekommen haben“, heißt es heute auf dem Blog der Betreiber. „In Zukunft werden wir die Botschaften wahrscheinlich abschwächen, damit sie mehr mit dem übereinstimmen, was wir tatsächlich glauben, und nicht einfach nur Clickbaiting sind…!“

Agent AI, übernehmen Sie! KI-Agenten könnten unsere Arbeitswelt in Zukunft stark verändern.
All diese Beispiele zeigen: Bedenken rund um agentische KI nicht ernst zu nehmen, wäre ein grober Fehler. Nicht nur der Schutz sensibler Daten ist entscheidend. Wir Menschen müssen verstehen, wie die Systeme funktionieren, und bereit sein, die Innovation mitzutragen und mitzugestalten. Das gilt insbesondere in Unternehmen: Mitarbeitende müssen darauf vertrauen, dass sich die Zusammenarbeit mit KI-Agenten lohnt – auch wenn das für manche bedeutet, sich umschulen zu lassen. Unternehmen werden also weiterhin einen starken Fokus auf ihre echten Mitarbeitenden richten müssen, damit KI ihren Zweck erfüllen kann: den teils deutlich spürbaren Arbeitskräftemangel abzufedern sowie Zeit und Geld zu sparen. Wobei: OpenAI arbeitet gerade an verschiedenen agentischen Modellen, die nach geleakten Informationen je nach Können und Einsatzzweck zwischen 2.000 und 20.000 US-Dollar kosten sollen – pro Monat.
Über die Autorin Nina Heger:
 Nach ihrem Bachelor in Buchwissenschaft und Germanistik war Nina jahrelang im Corporate Publishing tätig, bevor sie bei Adel & Link Wurzeln schlug. Als Senior Texterin beschäftigt sie sich heute mit den unterschiedlichsten Themen, Trends und Textsorten. Hier eine Case Study für Tech-Kunden, da ein Ratgeber für Inneneinrichtung oder ein Blogpost zu New Work: genau die richtige Mischung für die wortverliebte Copywriterin.
Nach ihrem Bachelor in Buchwissenschaft und Germanistik war Nina jahrelang im Corporate Publishing tätig, bevor sie bei Adel & Link Wurzeln schlug. Als Senior Texterin beschäftigt sie sich heute mit den unterschiedlichsten Themen, Trends und Textsorten. Hier eine Case Study für Tech-Kunden, da ein Ratgeber für Inneneinrichtung oder ein Blogpost zu New Work: genau die richtige Mischung für die wortverliebte Copywriterin.
Header: Adel & Link HIVE Studios
Fotos: Jonas Reuter (Matthias Lein), Marvin Fuchs (Nina Heger), Illustrationen: Freepik/Vektorjuice
