
30 Jun Digital Afterlife – Weiterleben als KI-Kopie
Grief-Tech-Anbieter aus aller Welt heben das Vermächtnis der Toten auf ein neues Level: Wir sollen uns nicht länger mit unseren Erinnerungen begnügen. Die Digital-Afterlife-Industrie verspricht ultrarealistische Interaktionen mit KI-Kopien – sofern wir das wollen und dafür zahlen. Oder?
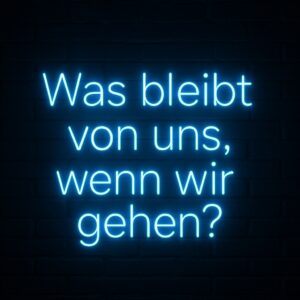 Der unheilbar an Krebs erkrankte Michael Bommer hat auf besondere Art vorgesorgt. Vor seinem Tod schuf er mit dem Anbieter Eternos seine eigene KI – mit echten Geschichten aus seinem Leben und unzähligen Stimmaufnahmen. In der WDR-Doku „Mein Mann lebt als KI weiter“ erzählt seine Ehefrau Anett Bommer von seinem digitalen Vermächtnis. Sie vergleicht die sprechende KI ihres verstorbenen Mannes mit einem Tagebuch oder Memoiren, aus denen er vorliest. Es fehlen die Gestik, Mimik und Emotionen, wenn er ihr auf Knopfdruck die Geschichte von seinem Heiratsantrag erzählt. Doch in seinen letzten Lebensmonaten war es für beide ein wertvoller Prozess, die KI mit Erinnerungen und Daten zu füttern.
Der unheilbar an Krebs erkrankte Michael Bommer hat auf besondere Art vorgesorgt. Vor seinem Tod schuf er mit dem Anbieter Eternos seine eigene KI – mit echten Geschichten aus seinem Leben und unzähligen Stimmaufnahmen. In der WDR-Doku „Mein Mann lebt als KI weiter“ erzählt seine Ehefrau Anett Bommer von seinem digitalen Vermächtnis. Sie vergleicht die sprechende KI ihres verstorbenen Mannes mit einem Tagebuch oder Memoiren, aus denen er vorliest. Es fehlen die Gestik, Mimik und Emotionen, wenn er ihr auf Knopfdruck die Geschichte von seinem Heiratsantrag erzählt. Doch in seinen letzten Lebensmonaten war es für beide ein wertvoller Prozess, die KI mit Erinnerungen und Daten zu füttern.
Viele Fragen rund um die KI-Kopien
Um eine digitale Kopie zu erstellen, braucht die KI vor allem eins: unsere Daten. Je mehr sie davon hat, desto genauer wird das künstliche Abbild. Michael Bommer hat sich aus freien Stücken dazu entschieden, seine eigene KI-Kopie zu erschaffen. Das ist der Idealfall für alle Beteiligten. Was aber, wenn jemand statt seiner eigenen KI-Kopie eine von mir entwirft? Kann ich das überhaupt verhindern? Dazu hält sich die Digital-Afterlife-Industrie eher bedeckt – hier stehen die positiven Aspekte im Vordergrund.
Aus einer kritischeren Perspektive berichten zwei Autorinnen, die eine fesselnde Multimedia-Story im Handelsblatt veröffentlicht haben (sehr lesenswert!). „Wenn die Toten auferstehen: Das Geschäft mit den Daten Verstorbener“ lässt erahnen, dass digitale Avatare von Grief-Tech-Anbietern nicht immer nur tröstliche Antworten im Gepäck haben. Besonders befremdlich: In den Chatgesprächen mit dem eigens erstellten „Ghostbot“ widerspricht die KI den Erinnerungen der Autorin und halluziniert munter drauflos. Was, wenn Trauernde das erleben müssen?
Digitale Trauer – ein Abschied auf Raten?

Matthias Meitzler von der Uni Tübingen sprach im Februar auf unserer Trendvernissage zum Thema Digital Afterlife.
In vielen Ländern wie China oder Südkorea gehen Menschen anders mit dem Tod um, dort scheinen die Entwicklungen bereits noch weiter vorangeschritten. 2020 besuchte eine koreanische Mutter den Avatar ihrer verstorbenen Tochter, um sich von ihr zu verabschieden. Aber geht es der Digital-Afterlife-Industrie wirklich ums Abschiednehmen oder eher um Abomodelle? Denn um mit der KI-Kopie zu interagieren, müssen die Angehörigen monatlich zahlen – oder sich irgendwann endgültig verabschieden.
Trauerforschung und ethische Aspekte rund um Digital Afterlife sind zwei Themenschwerpunkte von Matthias Meitzler, der im Februar auf unserer Trendvernissage sprach. Auf dem Blog der Uni Tübingen beschreibt er ausführlich, wie die KI eingesetzt werden kann und welche Fragen und möglichen Antworten sich daraus ergeben. Meitzler ist Mitglied der Forschungsgruppe edilife, die den Umgang mit Avataren und Chatbots von Verstorbenen untersucht hat. In ihren Forschungsergebnissen kommen sie zu dem Schluss, dass sich nicht verallgemeinern lässt, „ob die betreffenden technischen Anwendungen menschliche Beziehungen (sowohl zwischen Lebenden untereinander als auch zwischen Lebenden und Verstorbenen) erleichtern oder erschweren.“
Für Annett Bommers persönlichen Trauerprozess war die Technologie nicht wichtig, heißt es im Dokumentarfilm. Es sei einfach nicht ihre Art, mit der Trauer umzugehen. Ihn bringt es nicht zurück, aber es erinnert sie an das letzte Projekt ihres Mannes, das sie beide vor seinem Tod sehr beschäftigt hat – ihr ist es etwas wert, weil es ihm wichtig war. In den ersten Monaten der Trauerverarbeitung hat die Technologie ihr aber nicht geholfen.
 AI gegen Einsamkeit: Warum es nicht nur um Trauer geht
AI gegen Einsamkeit: Warum es nicht nur um Trauer geht
Trauerprozesse unterscheiden sich also nicht nur kulturell, sondern sind immer individuell. Und nicht nur der Tod kann Gefühle von Trauer und Sehnsucht auslösen: Auch nach einem Beziehungsende sehnen sich viele nach geliebten Menschen. Warum also nicht die Ex-Liebschaft oder den heimlichen Schwarm zum KI-Avatar umwandeln? Für die meisten von uns mag der Gedanke abstoßend sein, aber längst nicht für alle.
Digitale Nähe boomt. Für manche mag ein Fake-Chat verlockender klingen, als allein zu sein und sich einsam zu fühlen. Bis zu einem gewissen Grad kann digitale Vertrautheit funktionieren und positive Gefühle auslösen. Das dürften alle wissen, die anregende, witzige, liebevolle oder tröstliche Nachrichten per Messenger austauschen. Doch je weiter die Technologien aktuell voranschreiten, desto mehr Menschen flüchten sich regelrecht in die virtuellen Beziehungswelten. Und zwar mit allem Drum und Dran: Liebesbekundungen, Fragen nach dem allgemeinen Befinden, Flirten, Streiten, Deep Talk, Sexting.
Anbieter, die mit dem Erstellen von Charakteren werben, können damit viel Geld verdienen – aber auch einige Schwierigkeiten bekommen. Einige erziehen ihr Digital-Date gleich so, dass es ihnen immer alles recht macht. Gruselige Vorstellung von Beziehung? Absolut. Sogar Googles Ex-CEO Eric Schmidt warnt vor den Gefahren, die von vermeintlich perfekten KI-Freund:innen ausgehen: überdrehte Ansprüche, Radikalisierung, extreme emotionale Abhängigkeit.
Persönliche Vermächtnisse mit Potenzial
Trotz aller Bedenken ergeben sich durch künstliche Intelligenz und Digital-Afterlife-Technologien auch neue Möglichkeiten, die vorher undenkbar waren. In den ersten Songs und Podcasts kommen die Stimmen aus dem Jenseits direkt aus dem Lautsprecher. Die Idee dahinter: KI-generierte Stimmen und Avatare von echten Menschen können uns auf besondere Art inspirieren, indem sie deren Kunst, Wissen oder Erfahrungen mit uns teilen. In einer Ausstellung der Deutschen Nationalbibliothek können Besuchende noch bis 2026 mit den digitalen Kopien zweier Überlebender des Holocaust sprechen – in voller Lebensgröße.
In digitalen Vermächtnissen steckt also auch großes Potenzial für heutige und künftige Generationen. Je mehr wir uns mit dem Konzept Digital Afterlife auseinandersetzen, desto stärker drängt sich eine Frage auf: Was soll von uns bleiben, wenn wir sterben? Die Antwort darauf kann uns keine KI liefern –wir müssen sie selbst finden.
Über die Autorin Nina Heger:
 Nach ihrem Bachelor in Buchwissenschaft und Germanistik war Nina jahrelang im Corporate Publishing tätig, bevor sie bei Adel & Link Wurzeln schlug. Als Senior Texterin beschäftigt sie sich heute mit den unterschiedlichsten Themen, Trends und Textsorten. Hier eine Case Study für Tech-Kunden, da ein Ratgeber für Inneneinrichtung oder ein Blogpost zu New Work: genau die richtige Mischung für die wortverliebte Copywriterin.
Nach ihrem Bachelor in Buchwissenschaft und Germanistik war Nina jahrelang im Corporate Publishing tätig, bevor sie bei Adel & Link Wurzeln schlug. Als Senior Texterin beschäftigt sie sich heute mit den unterschiedlichsten Themen, Trends und Textsorten. Hier eine Case Study für Tech-Kunden, da ein Ratgeber für Inneneinrichtung oder ein Blogpost zu New Work: genau die richtige Mischung für die wortverliebte Copywriterin.
Header: Adel & Link HIVE Studios
Fotos: Marvin Fuchs (Nina Heger), Jonas Reuter (Matthias Meitzler), Unsplash/rapha wilde (Frau vor Pink), ChatGPT KI (Neon-Schriftzug)
